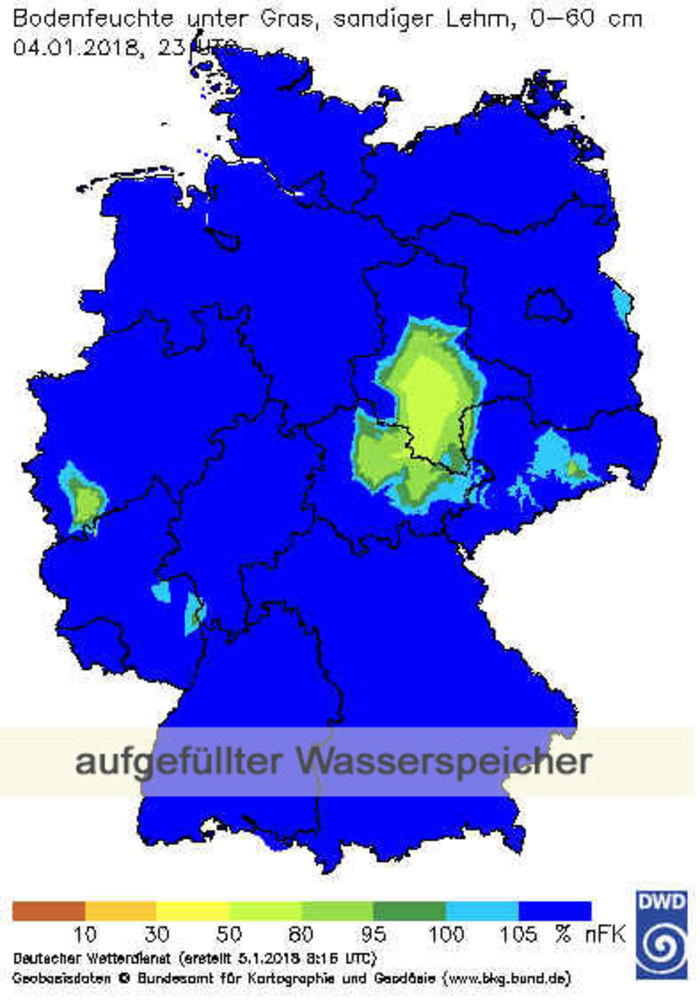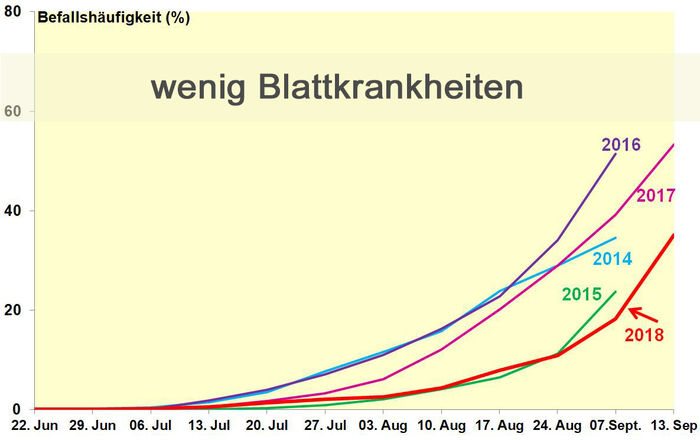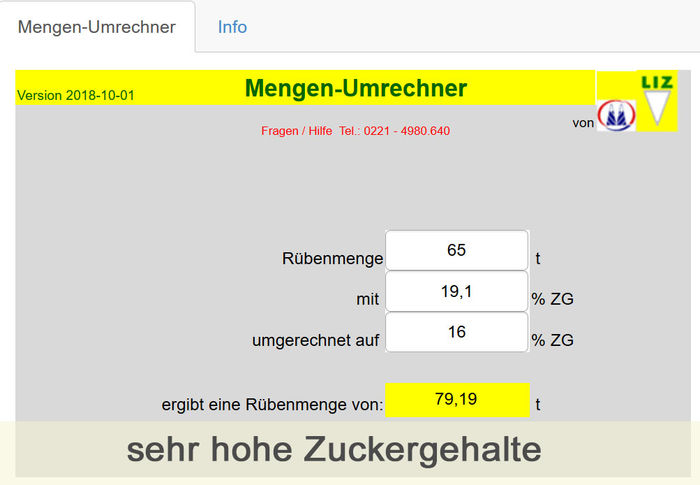Rückblickend gehört das Jahr 2018 für die meisten Anbauer zu den schwächeren Rübenjahren in den letzten 2 Jahrzehnten. Es ist durch einige Besonderheiten geprägt, die von guten Startbedingungen bis schwachen Ernteergebnissen variieren:
- aufgefüllter Wasserspeicher nach Jahreswechsel (Ausnahme Sachsen-Anhalte, Teile des Rheinlandes) und späte Frostperiode Anfang März
- späte Aussaat, langer Aussaatzeitraum
- wenig Neusaaten
- schnelle Jugendentwicklung und früher Reihenschluss
- normales Schosseraufkommen
- relativ problemlose Unkrautkontrolle trotz/dank schneller Unkrautentwicklung
- erste Trockenschäden bereits Mitte Juni sichtbar, erste Flächen werden beregnet
- schwacher Druck von pilzlichen Erregern, sowohl am Blatt, als auch an der Rübe
- massive Trockenschäden (nicht nur auf schwachen Standorten)
- kaum Probleme mit Fäulen (Rhizoctonia, Rotfäule…)
- extrem starker Befall mit Rübenmotte, v. a. im Osten und später auch im südl. Rheinland
- trockener Spätsommer mit extrem hohen Temperaturen und ausgeprägter Trockenheit
- deutliche Sekundärfäulen an schwachen Rüben nach Rübenmottenbefall
- später Kampagnestart aufgrund schwacher Rübenerträge
- sehr hohe Zuckergehalte
- extrem trockene Böden (Weizenaussaat teilweise schwierig; Zwischenfrüchte schlecht entwickelt)
- niedrige Massenerträge und teilweise sehr kleine Rüben erfordern angepasste Rodetechnik
- sehr schwacher Ertragszuwachs im Herbst
- starke Ertragsschwankungen in den Regionen und den Betrieben
- frühes Kampagneende
Das Anbaujahr 2018 ist aber auch gekennzeichnet durch die Diskussion um den Wegfall wichtiger Wirkstoffe bei Herbiziden (DMP/PMP), Fungiziden (Azole) und Insektiziden (Neonikotinoide). Dies wirkt beunruhigend, birgt aber auch die Chance auf Innovationen, die den Rübenanbau in Zukunft ökologisch und ökonomisch voran bringen.